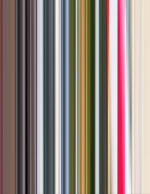WERK, BAUEN + WOHNEN | KOLUMNE | PAUL DIVJAK
Die Temperaturen sind längst gefallen, die Stadt hat dicht gemacht. Sommerliche Veranstaltungsorte entlang des Wiener Donaukanals liegen brach. Die Gastgärten und Strand-Settings der so genannten Eventgastronomie bleiben unbelebt, wirken wie fluchtartig verlassen, präsentieren sich als verödetes Bauland.
Das Freiluftbecken des Badeschiffes ist leer gepumpt, und selbst die sonst grell orange leuchtende Wellblechummantelung, deren gesamte Länge die Logos einer Direktbank zieren wie blinde Bullaugen, wirkt ungewohnt ausgewaschen. Lediglich aus dem Rumpf hört man spätabends dumpfe Klänge. Die Menschen haben sich in den Bauch des Schiffes zurückgezogen.
Stühle lagern hinter schmutzigen Containern. Gestapelt zu hohen Türmen erinnern sie an eine ausgemusterte Kolonie der Hochsitze von Tennisschiedsrichtern. Bambustische und anderes Mobiliar liegt verstreut hinter einfach gezimmerten Holzwänden.
Ein zu einer Grillstation umfunktioniertes aufgeschnittenes Ölfass lässt an Zeiten denken, in denen hier Fisch gegrillt und gesalzen, mit etwas Zitrone beträufelt serviert wurde. Die Ratten, die sich für gewöhnlich an diesem Ort tummeln, gehen jetzt leer aus, sie müssen anderswo nach Nahrung suchen.
Baumaschinenlärm hüben wie drüben. Hier entsteht eine neue Landungsbrücke für den Twin City Liner, die direkte Wasserverbindung von Wien nach Bratislava.
Am Ufer gegenüber klafft eine Lücke, ein Fundament ist im Entstehen. Nach Plänen der Ateliers Jean Nouvel errichtet eine Versicherung ein zeichenhaftes Gebäude mit identifikationsstiftender Wirkung. – Endlich ein Lichtblick: ein Anhaltspunkt, in diesen vom SAD-Syndrom bestimmten Tagen!
Die im Freien stehende Bar eines Lokals, das im Sommer der Gesellschaft als Bühne dient, ist grossflächig ummantelt. Der blecherne Schutz evoziert Bilder von, in Kriegszeiten hinter schützenden Ziegelsteinhüllen verborgenen Denkmälern und Brunnen.
Der Glascontainer, dessen blaue Stahlträger einst zumindest seine Wiedererkennbarkeit gewährleistet hatten, wirkt hoffnungslos abgenützt. Einer Grenzstation eines ehemals kommunistischen Nachbarstaates gleich, steht das Restaurant da. Nahe am Wasser gebaut, verschwindet es hinter der eigenen Schmutzschicht.Die Farben bleiben blass. Grau ist die Farbe der Saison, es nieselt.
Hochhäuser, die im Sommerlicht glänzten, deren Glasfassaden und Metallstrukturen reflektierten, die vor dem Hintergrund des blauen, wolkenfreien Himmels ideale Motive für ArchitekturfotografInnen abgaben, stehen nun farblos und nachgerade unauffällig nebeneinander. Uninspiriert warten sie auf besseres Wetter, auf vorteilhafteres Licht.
Ein winterfester Angler steht verloren in der Nähe einer Brücke. Seine Khakikleidung und der Camouflage-Hut fügen sich in das melancholische Ensemble, dessen Hintergrund der Schlot der von Friedensreich Hundertwasser verzierten städtischen Müllverbrennungsanlage bildet.
Nun drängt sich ein von Zaha Hadid gestaltetes, mehrteiliges Objekt ins Bild, errichtet zwischen Kanal und Schnellstrasse, über der denkmalgeschützten, ehemaligen Trasse der einstigen Stadtbahn. Geplant als luxuriöser Apartmentbau mit Geschäftseinheiten und Gastronomieflächen, nach langjähriger Adaption in veränderter Form erbaut, ist der stararchitektonische Koloss schlussendlich seelenlos inmitten einer städtebaulichen Wüste gestrandet. Mit zunehmender Zahl der Gebäudestützen und Schiessschartenfenster hatte sich Hadid, dem Vernehmen nach von dem Projekt distanziert. Der Bauträger schlitterte Ende des Jahres 2006 in die Pleite.
Der Wind bläst rau in die verwinkelten, leblosen Nischen, die sich bei näherer Betrachtung als Eingangsbereiche entpuppen.
Der öde Komplex scheint zur Gänze unbewohnt. Nur eine auf dem Dach eines der Baukörper montierte terrestrische Antenne, an deren Mast eine Satellitenschüssel befestigt ist, zeugt davon, dass es hier wohl doch menschliches Leben gibt. – Oder zumindest einmal gegeben hat.
[In: werk, bauen + wohnen, 1+2/2008]