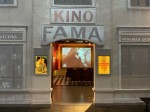WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 03_2021 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
»The year 1938 revealed a shameful fiasco of international diplomacy.«
Joseph Tennenbaum
Holocaust Memorial Day 2021: ein öffentlicher Bücherschrank, Bücher zur freien Entnahme; ringsum liegt tiefer Schnee. Seit Wochen haben die Buchhandlungen wie der gesamte Einzelhandel geschlossen, das öffentliche Möbel scheint wie eine bibliophile Fata Morgana, eine flirrende poetische Verheißung. Die schwere Türe, metallumrahmtes dickes Glas, öffnet sich sanft gleitend, lässt an einen riesigen Outdoor-Weinkühlschrank denken. Nahezu neue Taschenbücher, noch mit Preisschild auf dem Backcover, Bestseller vergangener Tage, feministische Literatur, antiquarische Bände, Bildbände, Nachschlagewerke, Kinderbücher; Bekanntes, Unbekanntes, Gewichtiges, Vergessenes aus verschiedenen Jahrzehnten.
Zwischen Martin Suters Der letzte Weynfeldt, diversen Krimis, zeitgenössischen Thrillern und Landschaftsfotobänden findet sich unvermittelt ein Konvolut: Neunhundertjahre „Muttergemeinde in Israel“ Frankfurt am Main 1074–1974. Chronik der Rabbiner, herausgegeben von Paul Arnsberg, 1974; Die israelische Gesellschaft von S. N. Eisenstadt, 1973; Treblinka. La révolte d’un camp d’extermination von Jean-François Steiner mit einem Vorwort von Simone de Beauvoir, 1966; Vergangen und ausgelöscht. Erinnerungen an das slowakisch-ungarische Judentum, Eran Laor, 1972; Yad Washem Studies on the European Jewish Catastrophe and Resistance, herausgegeben von Shaul Esh, Jerusalem, 1958; sowie: Auschwitz in England. A Record of a Libel Action von Mavis M. Hill und L. Norman Williams, 1965.
Der Historiker und Autor Paul Arnsberg wurde 1899 in Frankfurt am Main geboren, emigrierte nach Palästina und kam 1958 nach Deutschland zurück. Er war unter anderem Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt (1966–1969) und Vorstand des Zentralrats der Juden (1966–1973), Arnsberg und seine Frau wollten nach Israel zurückkehren, er starb jedoch 1978.
Der Soziologe Shmuel Noah Eisenstadt wurde 1923 in Warschau geboren und starb 2010 in Jerusalem. Der Schriftsteller Jean-François Steiner wurde 1938 geboren, sein Vater 1944 in Auschwitz umgebracht, sein Tatsachenroman Treblinka. Die Revolte eines Vernichtungslagers, ein Bestseller in den späten 1960er-Jahren, gilt als umstritten.
Der Philosoph Eran Laor wurde 1900 in Cifer, Slowakei, geboren und starb 1990 in Jerusalem.
Ich schlage den Band Auschwitz in England auf und stoße, eingeschlagen in den Schutzeinband, auf einen Originalzeitungsauschnitt aus Le Monde, datiert mit: „15/7/65: LE Dr DERING médecin d’Auschwitz EST MORT À LONDRES“ …
Meine Großmutter hatte zu Lebzeiten die Angewohnheit, themenspezifische Zeitungsartikel auszuschneiden, sorgfältig zu beschriften und in Büchern, die für sie mit persönlicher Geschichte verbunden waren, zwischen Klappentext und Vorblatt einzuschlagen und aufzubewahren. Noch Jahre nach ihrem Tod sind in Büchern aus ihrer Bibliothek unvermittelt vergilbte Ausschnitte aufgetaucht, die mit handschriftlichen Notizen versehen waren.
Wem wohl all die Bände in dem winterlichen Schrank einst gehört haben mögen? Handelt es sich um Bestände einer größeren, umfassenden Bibliothek? Ist der*die Besitzer*in verstorben, und die Angehörigen haben Nachlassbruchstücke „entsorgt“? Wollte der*die Besitzerin durch sie nicht mehr an die eigene Vergangenheit oder die Familiengeschichte erinnert werden? Hat ein Nachkomme eines Kriegsverbrechers mit der Vergangenheitsbewältigung (der Vorfahren) abgeschlossen? Handelt es sich um Teile der verwendeten Literatur für eine einschlägige wissenschaftliche Arbeit, die nach Fertigstellung des Papers, der Sponsion oder Promotion nicht weiter benötigt worden ist?
„Auf der Welt ist jetzt mehr Totes als Leben“, meldete neulich das Weizmann Institute of Science und wies darauf hin, dass gegenwärtig Menschengemachtes („anthropogenic mass“) erstmals mehr wiegt als Biomasse. Allein das weltweite Plastik wiegt schwerer als alle Tiere.
Ich packe die Bücher sorgfältig ein und trage sie nach Hause; schwere Vergangenheit, menschengemacht.
[wina - 03–2021]