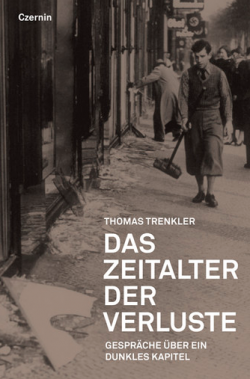[Erschienen in: wına – Das jüdische Stadtmagazin | Juni 2012]
[Erschienen in: wına – Das jüdische Stadtmagazin | Juni 2012]
Jene Nummer, die die Beastie Boys – damals noch als Punk-Band – in der High School 1983 intoniert hatten, sollte schon wenig später zu ihrem offiziellen Programm werden: „We’re the white shadow“, singt Mike D. aka Michael Diamond. Am Schlagwerk, temporär: Kate Schellenbach, die spätere Drummerin von Luscious Jackson, an der Stromgitarre John Berry und am Bass: Adam Yauch alias MCA.
John Berry verließ die Band, und Adam Horovitz (Ad-Rock) übernahm seinen Part. Der Rest ist Hip-Hop-Geschichte. Die drei weißen Jungs aus Brooklyn, NY, wilderten in einem Genre, das in der Black Community entstanden war, kreierten einen neuen Sound und schafften, was zu jener Zeit, Anfang der 1980er-Jahre, doch eher die Ausnahme denn die Norm war: Sie sprachen mit ihrem innovativen Hip-Hop-Rock-Crossover ein multiethnisches Publikum an, verwöhnten die juvenilen Fans mit expliziten Lyrics und vereinten sie auf den Tanzflächen der Clubs, auf Partys und im Rahmen ihrer legendären Live-Performance-Spektakel beim gemeinsamen Luftgitarre-Spielen, ekstatischen Mitwippen und -grölen sowie enthemmten Bierbecherweitwerfen.
„I’m gonna die gonna die one day ’cause I’m goin’ and goin’ and goin’ this way.“ Adam Yauch, aka MCA – The Sound of Science
„The best Jews since Jesus“ sagen die einen über die Beastie Boys. „Yauch, Diamond and Horovitz weren’t Matisyahu, but they embraced their yiddishkeit“ die anderen. Und wieder andere bringen es auf den Punkt und meinen ganz einfach: „Beastie Boys rule!“
„There was something about MCA that I always liked“, stellt der popkultur- und technikaffine Rabbi Jason Miller aus Michigan, der für die New York Jewish Week und die Huffington Post schreibt, stellvertretend fest.
Und tatsächlich: Jedes der drei Bandmitglieder war von Anfang an auf seine ganz persönliche Art „cool“. Adam Yauch aber, mit seinem verwegenen 3-Tage-Bart und seinen souveränen, lässig-schlacksigen, das authentische Posen-Gehabe aufs Korn nehmenden Quasi-Rapper-Moves, war für viele schon vom ersten Moment an der zeremonielle Mittelpunkt, der Großmeister des kultiviert-subversiven Auszuckens, des poprituellen Abfeierns als Gegenentwurf zum parentalen Business of Living. Im Lauf der Jahre hat er, auch abseits der Bühne in Interviews, durch seine herzliche Gelassenheit, seine humorvolle, sympathische Art und sein freudvolles Lächeln die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So gar nicht von der Pop-(Image-)Maschinerie kaputt gemacht, war Adam Yauch, der Star, vor allem eines: ein Mensch – und zwar einer von den Guten.
Yauchs Krebstod Anfang Mai 2012, mit gerade einmal 47 Jahren, trifft neben seiner Familie und seinen Freunden mehrere Generationen von ehemals und gegenwärtig Pubertierenden, deren Leben vom Soundtrack und dem medialen Referenzuniversum der sich musikalisch stetig weiterentwickelnden New Yorker Musiker geprägt und begleitet worden ist.
Es war stets ein energiegeladenes Lebensgefühl, das die Beastie Boys mit ihrer Musik auf den Punkt brachten
You talk, you talk, you just can’t stop … Adam Yauchs etwas kratzige Stimme, sein spezielles, heiseres Timbre erdet die Songs mit seinem charakteristischen Sprechgesang, um kurz darauf mit seinen zwei Mitstreitern im anarchistischen, von Filtern und Effekten geprägten Wortgefecht Megaphonhysterik zu verbreiten und chorale Hooklines abzufeuern.
So gar nicht von der Pop-(Image-)Maschinerie kaputt gemacht, war Adam Yauch, der Star, vor allem eines: ein Mensch – und zwar einer von den Guten.
Dass Yauch und seine Wegbegleiter Spaß an der Sache hatten, hörte man. Und das sah man auch.
Der kreative Allrounder Yauch, Musiker, Begründer einer Independent-Film-Company und der Milarepa Foundation, mit der er unter anderem die Free-Tibet-Konzertserie ins Leben gerufen hatte, zeichnete unter seinem Pseudonym Nathaniel Hörnblowér auch als Regisseur für einige der, oftmals bewusst trashigen, selbstironischen, mit popkulturellen Versatzstücken gespickten, ikonografischen B-Movie-Verkleidungsvideokaskaden der Band verantwortlich – unter anderen Intergalactic oder Body Movin. Auch das aufwendige, finale 30-Minuten-Epos Fight for your right – Reloaded samt Narrationsappendix Make some noise (2011), in denen ein Hollywood-Staraufgebot antritt, um das musikalische Œuvre der ewig bösen Jungs, die doch eigentlich nur spielen wollen, zu beleben und ihm gleichzeitig seine Referenz zu erweisen, ist unter seiner Ägide entstanden.
Da klettern Elijah Wood, Danny McBride und Seth Rogen als Beastie-Boys-Klone aus dem Trockennebel der Vergangenheit, um im Hier-und-Jetzt als jugendliche Delinquenten ihre Idee von feucht-fröhlichem Anarchospaß im öffentlichen Raum auszuleben.
In der Schlusssequenz – inszeniert als klassisches Showdown à la High Noon – hält ein DeLorean, direkt zurück aus der Zukunft: Ihm entsteigen drei weitere – gealterte, fett gewordene Beasties: Will Ferrell, John C.Reilly und Jack Black.
Jede der Belegschaften erklärt mit Nachdruck, bei ihr handle es sich um „the real Beastie Boys“. In einer klassischen Freestyle-Breakdance-Battle soll die Legitimität der Behauptung auf den Hip-Hop-Thron bewiesen werden. Auf einer schachbrettgemusterten Unterlage stellen die Herausforderer skurrile Verrenkungen als Beweismittel zur Schau.
„Sense is something you can’t even make sense of until you’ve been to the future and spent some time there“, verkündet Jack Black als Yauchs Alter Ego vollmundig. – Keiner versteht ihn. Und alle tanzen.
Angesichts des Todes von Yauch wird die fiktive Verdoppelung der Band, die leichtfüßig in Szene gesetzte, narrative Präsenz von Vergangenheit und Zukunft der Protagonisten, zum opulenten Vermächtnis des Regisseurs und Musikers, zu einer Eloge, in der sich die vielgesichtige Gestaltungsfreude des kreativen Trios ein letztes Mal verdichtet und die an das Mögliche erinnert – gleichsam als augenzwinkernder Trost für all jene, denen Adam Yauch und die einzig wirklich wahren Beastie Boys hinkünftig verdammt fehlen werden.