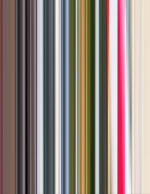WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 08_2021 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
»I’m passionately involved in life; I love its change, its color, its movement.
To be alive, to be able to see, to walk, to have houses, music, paintings – it’s all a miracle.« Arthur Rubinstein
Wir sitzen im Speisewagen nach Warschau und verkosten uns durch die Speisekarte. Es gibt polnisches Frühstück, dann griechischen Salat, später Piroggen, Apfelspalten und viel Kaffee. Die Landschaft zieht vorbei. In der Ferne entdecken wir in der tschechischen Ebene scheinbar verlassene, karge, gerüstartige Siedlungen, immer mehr. Der nähere Blick zeigt: Es handelt sich um Dörfer, die der Juni-Tornado verwüstet hat. Ganze Landstriche sind betroffen; zerdrückte, umgekippte Autos, geknickte Bäume, abgedeckte Häuser. Bagger bearbeiten Berge von Müll und Hausrat. Freiliegende Dachstühle werden repariert, die Feuerwehr ist im Einsatz, Menschen sind in verwüsteten Weingärten zugange. Dann mit einem Mal ist der Spuk unvermittelt vorbei; Wiesen, Felder, Wälder.
In Warschau begrüßen uns der bunt erleuchtete Pałac Kultury und nächtliche Sommerluft.
Für die nächsten Tage besteht Hitzewarnung. Die Sonne brennt auf die Stadt nieder. Auf dem Rondeau der Aleje Jerozolimskie steht sie noch, die vor 19 Jahren von der Künstlerin Joanna Rajkowska errichtete artifizielle Palme – nebst dem Kulturpalast so etwas wie ein klimawandeladäquates Wahrzeichen der Stadt. Die Installation trägt den Titel Greetings from Jerusalem Avenue.
Der Koloss des POLIN, des Museums für die Geschichte der polnischen Juden, erhebt sich auf dem Areal des ehemaligen Ghettos gegenüber dem Monument, vor dem Willy Brandt 1970 mit seinem historischen Kniefall symbolische Diplomatiegeschichte geschrieben hat.
Im Inneren des Museums, dessen Eingangshalle, obgleich mit massivem, hölzern anmutendem Stein verkleidet, durch seine organischen, wellenartig-ineinanderfließenden Formen fasziniert, sorgt in Folge nicht nur die die extreme Klimatisierung für Gänsehaut.
Große Glas-Screens im Entree, auf denen Silhouetten eines nebelverhangenen Waldes samt vorbeihuschender Tiere projiziert werden, bilden den märchenhaften Einstieg in die jüdische Besiedelungsgeschichte des Gebiets des heutigen Polens („Polin“, im Deutschen so viel wie „hier kannst du ruhen“).
Die Vermittlung setzt auf historische Artefakte, seltene Judaica, Illustrationen von Handelswegen, Darstellung der Besiedelung, von Lebensalltag und Gemeinschaft, von Wachstum und kultureller Blütezeit sowie die territorialen Veränderungen und Konflikte in der Rzeczpospolita.
Szenografisch werden Marktplatz, Gasthaus, Stube und eine Replika der detailgenauen, handbemalten Holzdachkonstruktion der Synagoge von Gwoździec erlebbar gemacht. Die BesucherInnen passieren die weitläufige Kulisse einer jüdischen Gasse mit Kopfsteinpflaster, Laternen und Fassadenprojektionen in Schwarzweiß; Fenster zeichnen sich ab, Läden und Reklameschilder. Warmes Licht dringt aus dem Portal des Kinos „Fama“, in einem Tanzsalon spielt leise Grammophonmusik – und hinter der nächsten Ecke erfasst uns die Aufbereitung der unfassbaren Brutalität des Nationalsozialismus mit Segregation, gesetzlich legitimierten Sanktionen, Enteignungen, Verschleppungen, Massenmord – der Abgrund des Holocausts. In engen, abgeschrägten, niedrigen Betonräumen wird Geschichte vermittelt, der sich polnische Politiker heute zu entziehen versuchen. Erst jüngst wurde das POLIN zum Politikum, die neue Leitung wurde vom Kulturministerium bestimmt, PIS hat mit Gesetzesänderungen bezüglich des Umgangs des Landes mit dem Holocaust sowie in Bezug auf Restitutionszahlungen einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt.
Draußen scheint die Sonne. In Warschau genießen die Menschen den Sommer; am Ufer der Weichsel, in Restaurants, Bars und in den Gastgärten vor den Lokalen auf der Nowy Świat; Shishas verströmen ihr Aroma, Liegestühle laden zum Verweilen bis in die Morgenstunden ein.
Nach einem Zwischenstopp im Restaurant Warszawa Powile in einer ehemaligen PKP-Ticketverkaufsstelle aus den 1950er- Jahren besuchen wir einen legendären Jazzclub. Die MusikerIn- nen improvisieren, begeistern das Publikum. Die Gäste begrüßen einander lachend mit Wangenküssen, umarmen einander. Es ist, wie nach den großen Ferien, damals: Das lang ersehnte Wiedersehen im Herbst mit den besten SchulfreundInnen. – Eine Freude, die potenziell ansteckend sein kann.
[wina - 08–2021]

 WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 5_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 5_2017 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK