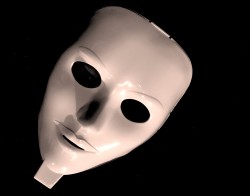WINA – DAS JÜDISCHE STADTMAGAZIN 5_2016 | URBAN LEGENDS | PAUL DIVJAK
„Tomorrows unitary world is in need of transcendence and liberation from a thinking in opposites.“ George Czuczka
Weltanschauungen lassen sich nicht verordnen. Aber es lassen sich gesellschaftliche Bedingungen schaffen, die zur Veränderung von tradiertem, vorurteilsbehaftetem Denken beitragen.
Wir sind überinformiert – und empfinden uns zunehmend als machtlos. Entscheidet man sich für den Medienkonsum, lassen einem Quantität und Komplexität des real existierenden Wahnsinns keine Verschnaufpause. Und die schlimmsten Bilder erreichen unser Bewusstsein gar nicht mehr.
Unsere Welt ist erfüllt von Angst. Radikalisierungen allerorts – und der Begriff „Kampf“ ist in aller Munde. Gekämpft wird gegen Körpergeruch und den Feind im eigenen Körper – die Zivilisationskrankheit Krebs –, gekämpft wird für Ideologien, für politische und religiöse Überzeugungen und gegen illegale Finanztransaktionen von so genannten Global Players. Gekämpft wird gegen Feinde und Feindbilder – die Idee eines Feindes.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass offizielle Sprachdoktrinen nicht fruchten. So hat beispielsweise die DDR versucht, dem Volk ein neues Denken zu verordnen. Ohne nachhaltigem Erfolg freilich.
Hatte man in der Zeit des „Bollwerks gegen Faschismus und Imperialismus“ darauf gesetzt, Worte aus dem Sprachgebrauch zu entfernen, um die damit verbundenen Konnotationen aus Alltag und kollektivem Gedächtnis zu löschen, so lässt sich heute, über 25 Jahre nach dem Mauerfall sagen: Es liegt nicht alleine an Begrifflichkeiten – in den Köpfen spukt es weiter. Von einem autoritären Regime übergangslos zum ächsten: Das hinterlässt Spuren in den Synapsen.
Heute sehnen sich viele nach Grenzen, wie es sie in der DDR einst gab: undurchdringlich mit Stacheldraht und Wachtürmen. Und nach einem pflichtbewussten Grenzschutz, der gegebenenfalls zur Waffe greift und auf Flüchtende schießt. – Wer die nationalen Grenzen verletzt, muss eben mit dem eigenen Tod rechnen. Oder wie Karl-Eduard von Schnitzler, der Paradeeinpeitscher des DDR- Fernsehens es einmal sinngemäß formuliert hat: „Wer auch immer die Grenzen der DDR überschreiten will, benötigt die Genehmigung dazu. Andernfalls: Bleiben sie unseren Grenzen fern! All jene, die sich der Gefahr aussetzen, werden sterben. (…) Es ist human, den Frieden für alle Menschen auf Erden zu sichern. Und das passiert nicht durch Gebete. Es passiert durch Kampf. (…) Es ist human, diesen Staat geschaffen zu haben. (…) Es ist human, die DDR gegen Menschen zu schützen, die sie zum Frühstück verspeisen wollen.“
Die offizielle Narration des Arbeiter- und Bauernstaates lautete: Die Grenzen sind dazu da, euch zu schützen. Denn dort draußen lauert die Gefahr.
Die Angst, offiziell geschürt im Namen der inneren Sicherheit, bleibt bedrohlicher Subtext und im Dunklen. Die Logik des „Schutzwalls“ gegen das andere, gegen
Feinde des Staates, gegen Kräfte, die alles tun, um ihn zu destabilisieren und zu zersetzen, wirkt nach. Sie erfährt Wiederbelebung, sie wird unter anderen Vorzeichen fortgeschrieben. Und die Angst derer, die sich im Zuge der postkommunistischen Geschichte als Vergessene und Übriggebliebenen empfinden, ist – auch in Ländern wie Polen und Ungarn – zu Wut und zu Hass geworden.
Weltanschauungen lassen sich nicht verordnen. Aber es lassen sich gesellschaftliche Bedingungen schaffen, die zur Veränderung von tradiertem, vorurteilsbehaftetem Denken beitragen.
Es wird noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis die Mechanismen der strukturellen Gewalt der DDR aufgedeckt und diskutiert werden, bis kollektive Erfahrungen einer Gesellschaft beleuchtet und Zeitgeschichte neu gelesen werden können.
Die Geschichte von Ländern und ganzen Regionen wird sich in Hinkunft und rückbezüglich anders darstellen, dazu tragen Leaks, investigativer Journalismus, die Öffnung von Archiven, zivilgesellschaftliche Initiativen, individuelle und kollektive (Bewusstseins-)Bildung bei.
Was feststeht, ist, dass wir nicht warten können, bis wir uns die „wahre Geschichte“ des Hier und Jetzt erzählen können. Wir benötigen dringend neue Erzählungen – und zwar EU-weit. Erzählungen, die für einen sozialen, kulturellen und ökologischen Wandel stehen, die von Empathie und einem Miteinander, kluger Politik und gemeinsamen Perspektiven geprägt sind.
[wina - 5.2016]