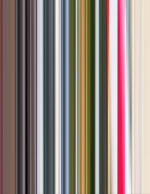WERK, BAUEN + WOHNEN | KOLUMNE | PAUL DIVJAK
WERK, BAUEN + WOHNEN | KOLUMNE | PAUL DIVJAK
Aus Heuersdorf, südlich von Leipzig gelegen, hatte man im Herbst 2007 die mittelalterliche Emmauskirche abtransportiert. Mit Hilfe eines Schwertransporters wurde das Gotteshaus in einen zwölf Kilometer entfernten Nachbarort verfrachtet. Die über 750 Jahre alte Kirche musste dem Braunkohleabbau weichen. Im Interesse der Allgemeinheit hatte der Verfassungsgerichtshof die Zerstörung von Heuersdorf genehmigt. Durch die Jahrhunderte von Zivilisation bestimmte dörfliche Struktur wurde zum Abbruch freigegeben, die Bevölkerung umgesiedelt. Bauernhöfe, Wohnhäuser, das Gemeindezentrum und der Friedhof werden in absehbarer Zeit verschwunden sein. Dann wird nichts mehr an die einstige Ortschaft erinnern. Und monströse Maschinen dominieren das Bild einer kargen Wüstenlandschaft. Ein Foto, das ein Hobbyfotograf im September des vergangenen Jahres in Heuersdorf aufgenommen hatte, zeigt das Detail eine Telefonzelle der Deutschen Telekom, an einer verwaisten Dorfstrasse. Auf dem Display des Apparates steht: «Entschuldigung – Nur Notruf möglich.»
Gleichsam als dokumentarischer Ruf, der auf das sukzessive Verschwinden eines Ortes aufmerksam macht, lesen lässt sich auch der Bildband «Higley» des in Amerika geborenen und seit langem in Salzburg lebenden Fotografen Andrew Phelps. Ort der Bestandsaufnahme ist Higley, bei Phoenix, Arizona. Die Bilder der sehr persönlich motivierten und doch von einem behutsam distanzierten Blick geprägten Langzeitstudie über seinen ehemaligen Heimatort erzählen davon, wie Menschen leben, und wie der Prozess von Zersiedelung und Grundstücksspekulation Landschaft und unmittelbaren Lebensraum verändert.
Higley, einst eine von Landwirtschaft bestimmte Kleinstadt, stellt sich heute als zerklüfteter, vom Prekariat geprägter Landstrich einerseits und typisch amerikanische, konturlose Vorstadt andererseits dar. Hier dominieren karge Landschaft, Holzbaracken, provisorisch errichtete Stallungen und vereinzelte Häuser, umgeben von wild wuchernden Feldern. Um ein wenig Halt zu gewinnen, nehmen die Menschen Posen ein, die sich im Alltag bewähren. Sie verharren in ihrem Umfeld, vor Vertrautem, mit Verwandten.
Phelps zeigt leerstehende Häuser, menschenverlassene Räume. Durch die Ritzen des fotografischen Dispositivs dringt der Staub der vergangenen Jahrzehnte. Familienportraits zieren die Wände, Devotionalien schmücken die Winkel. Und immer wieder fällt der Blick auf gerahmte Landschaftsdarstellungen, idealisierte Projektionen unberührter Natur, zivilisatorische Entwürfe von Wildnis.
Vor einem Caterpillar sitzt ein Mann mit Cowboyhut. Sein T-Shirt ist staubbedeckt, er lächelt. An anderer Stelle verlaufen Baggerspuren im Sand. In Sichtweite werden Gebäude hochgezogen. Es sind Bürgersteige entstanden, Beleuchtungskörper installiert, Grasteppiche verlegt und Gated Communities errichtet worden. Mit genormten Vorgärten, und Fusswegen, die zu den Eingangstüren führen. «Smile you are being watched!», legt ein Schild in einem Bild nahe. Schöne neue Wohnwelt. Hier ist das Pendler- und Pensionistenglück zu Hause. Hier werden Träume von einem glücklicheren Leben wahr. Und es wird weitergebaut. Den Interessen des Marktes entsprechend, verändert sich ein Ort. Er wird zunehmend verwechselbarer mit dem nächstgelegenen, verschmilzt schliesslich via Freeways, Shopping Malls und Fastfood-Ketten zur Gänze mit ihm. Ein Phänomen unserer Zeit. Higley hat 2007 seinen Namen verloren. Es ist nun ein Teil von Phoenix.
Bei den Menschen, die Andrew Phelps in seinem Band portraitiert, könnte es sich auch um die ehemaligen Bewohner von Heuersdorf handeln. Die Gesichter und Haltungen legen Zeugnis ab von persönlicher Lebensgeschichte im Transit. Jenes Plakat, das ein Bewohner von Heuersdorf zuletzt in die Auslage seines kleinen Ladens geheftet hatte, würde sich auch im Fenster des verwahrlosten Holzhauses in Higley als passend erweisen: «Ich war ein Dorf».
[in: werk, bauen + wohnen, 3/2008]